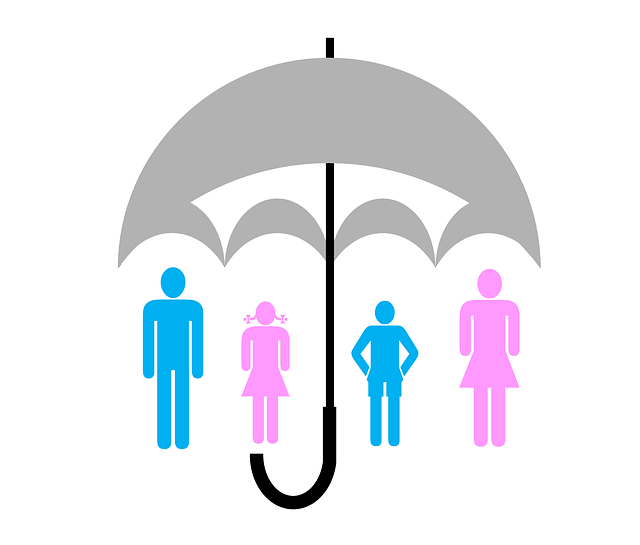
Freiwillige Krankenversicherung – Diese Vorteile überzeugen

Die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung stellt eine mögliche Versicherungsoption für Personen dar, die nicht der Pflichtversicherung unterliegen. Diese Form der Versicherung richtet sich an eine Vielzahl von Personen, so etwa Selbstständige, Studentinnen und Studenten, Rentnerinnen und Rentner, Beamtinnen und Beamte und weitere Personen, die nicht aufgrund ihres Arbeitsentgeltes und der Arbeitnehmerposition gesetzlich versichert sind. Auch Kinder können hier mitversichert werden.
Aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche die Versicherungspflichtgrenze überschreiten und daher keine Pflichtversicherte mehr sind, können als “Gutverdiener” in die freiwillige Krankenversicherung wechseln. In diesem Beitrag beleuchten wir die verschiedenen Aspekte der freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung und wie sie unterschiedlichen Personengruppen eine wichtige Absicherung im Krankheitsfall bieten kann. Dabei werfen wir auch einen Blick auf den Vergleich zur privaten Krankenkasse.
Freiwillig in die gesetzliche Krankenversicherung – das sollten Sie wissen
Wer nicht verpflichtet ist, Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung zu sein, der kann sich freiwillig gesetzlich krankenversichern. Dieses Wahlrecht kommt aber nur gewissen Personen zu, welche sich – wenn nicht freiwillig gesetzlich – auch privat versichern könnten.
Ab wann sich jemand auch privat oder freiwillig versichern lassen kann, bestimmt sich nach der Jahresarbeitsentgeltgrenze. Hierbei handelt es um die Grenze, bis zu der ein Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist.
Im Jahr 2023 liegt die Jahresarbeitsentgeltgrenze für die GKV bei 66.600 Euro im Jahr.
Freiwillige Versicherung: Die Vorteile auf einen Blick
Wenn keine Versicherungspflicht besteht, kann man sich über die gesetzliche Krankenkasse/ Krankenversicherung (abgekürzt GKV) freiwillig krankenversichern. Dies bietet eine Handvoll Vorteile:
Für die freiwillige Krankenversicherung spricht die Höhe der Beiträge im Alter, welche bei einer privaten Versicherung steigen. Dies ist in der Regel zwar mit Mehrleistungen und der Altersrückstellung seitens der PKV verbunden, von denen aber nicht jeder Gebrauch machen möchte. Die Beiträge bei der gesetzlichen Kasse erhöhen sich hingegen nicht nur wegen des Alters.
Auch für Eltern kann die freiwillige GKV eine gute Wahl sein, da die Kinder beitragsfrei im Rahmen der Familienversicherung mitversichert werden können.
Ein großer Unterschied zur privaten Krankenversicherung und gleichzeitig enormer Vorteil liegt darin, dass es keine Gesundheitsprüfung gibt und der GKV Beitrag unabhängig von Vorerkrankungen oder Risikozuschlägen (wie etwa in einer Berufsunfähigkeitsversicherung) besteht.
Wer sich später doch noch für die private Krankenversicherung entscheidet, kann immer noch hierhin Wechseln.
Wer kann sich freiwillig versichern lassen?
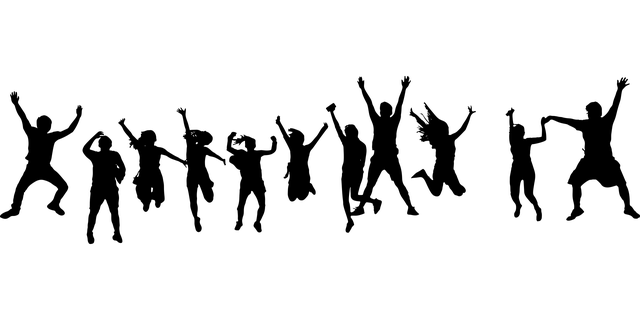
Nach § 9 SGB V können sich folgende Personengruppen freiwillig gesetzlich versichern, wenn sie bereits zuvor bei einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren:
- Menschen, die bislang Mitglied einer kostenfreien Familienversicherung waren, die nun erlischt.
- Kinder, welche nicht familienversichert sind, da der Elternteil mit dem höheren Einkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt und aus diesem Grund privat versichert ist.
- Arbeitnehmer, wenn ihr Bruttoeinkommen die Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt.
- Schwerbehinderte Menschen, wenn sie selbst, ein Elternteil oder der Ehepartner in den letzten fünf Jahren für mindestens drei Jahre gesetzlich versichert waren. Hier sollte jedoch auf eine mögliche Altersgrenze geachtet werden, welche sich in der Satzung der jeweiligen Krankenkasse findet.
- Beamte
- Zeitsoldaten, die ihre Dienstzeit beendet haben
- Selbstständige und Freiberufler (hauptberuflich)
- Ärzte
- Studierende, welche die Voraussetzungen der Krankenversicherung der Studenten nicht (mehr) erfüllen
- Rentner, welche die Voraussetzungen der Aufnahme in die Krankenversicherung der Rentner nicht mehr erfüllen
- Personen, die aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind und in den vergangenen fünf Jahren vor dem Ausscheiden mindestens 24 Monate oder unmittelbar vor dem Austritt ununterbrochen für mindestens zwölf Monate versichert waren ( dies sind die sog. Vorversicherungszeiten)
- Arbeitnehmer, die erstmals in Deutschland einer Beschäftigung nachgehen und sofort ein regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt von mindestens 5.550 Euro verdienen
Zusammengefasst: Personen, die keiner Versicherungspflicht der GKV unterliegen oder bei denen diese Pflicht beendet ist, können sich freiwillig bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichern lassen.
Gut zu wissen: Wer nicht zwingend gesetzlich pflichtversichert ist, dem kommt eine Wahlfreiheit zwischen der freiwilligen Krankenversicherung (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV) zu.
Das sollten Selbstständige wissen
Das Einkommen von Selbstständigen und Freiberuflern ist nur selten jeden Monat gleich hoch, es ist schließlich nicht mit dem Gehalt eines Angestellten zu vergleichen. Bei den Beiträgen der GKV wird aber genau dieses monatliche Einkommen zur Bestimmung der Höhe herangezogen. Daher schätzt die Krankenkasse das zu erwartende Einkommen zu Beginn der selbstständigen Tätigkeit und setzt dieses dann auf Grundlage des ersten Einkommensteuerbescheids fest.
Für Selbstständige, die bereits einige Jahre nicht mehr in einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis stehen, läuft die Beitragsberechnung seitens der Versicherung wie folgt ab:
Die Krankenversicherung setzt die Beitragshöhe auf Basis des letzten Einkommensteuerbescheids für ein Jahr vorläufig fest (sog. Festsetzung). Liegt der Steuerbescheid für das entsprechende Jahr vor, wird der festgesetzte Beitrag anhand der tatsächlichen Zahlen korrigiert. Dies kann zu einer Nachzahlung oder einer Rückzahlung führen: Verdiente der Versicherer mehr, als ursprünglich angenommen, wird er Beiträge an die Versicherung nachzahlen müssen. Im umgekehrten Fall, wenn also weniger verdient wurde als festgesetzt, erhält der Versicherungsnehmer Geld zurück. Die Frist zur Einreichung des Einkommensteuerbescheids beträgt drei Jahre. Diese Frist sollte auch dringend eingehalten werden, da die Krankenkasse andernfalls den Höchstbetrag rückwirkend verlangen kann, vgl. § 240 Abs. 4a SGB V.
Kommt es aus irgendwelchen Gründen dazu, dass das Einkommen des Versicherten im laufenden Jahr um mehr als 25 Prozent einbricht, kann eine Neuberechnung der Beiträge beantragt werden. Das gesunkene Einkommen kann durch einen Vorauszahlungsbescheid oder einen Nachweis der Finanzverwaltung belegt werden.
Gut zu wissen: Es besteht auch die Möglichkeit, von sich aus den Höchstbetrag zu zahlen, um dann jährlich ggf. Geld zurückzubekommen und nicht in die Verlegenheit zu geraten, einen enormen Betrag nachzahlen zu müssen.
Versicherungspflicht: Beginn und Ende
Jeder Bürger muss in Deutschland krankenversichert sein, dies ist eine Pflicht.
Wer gesetzlich versicherungspflichtig ist, steht in § 5 SGB V. Die Versicherungspflichtgrenze, auch Jahresarbeitszeitgrenze (kurz JAEG) genannt, ist hingegen nicht gesetzlich geregelt, sondern wird jährlich neu durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt – die Werte sind bundesweit gleich. Diese Grenze sagt aus, ab welchem Bruttojahresentgeld diejenigen nicht mehr die Pflicht haben, gesetzlich versichert zu sein, sondern die Wahl erhalten, sich auch privat versichern zu lassen.
Bei Arbeitnehmern kann die Versicherungspflicht jedoch dann erlöschen, wenn sie ein neues, höheres Bruttogehalt erhalten und die Jahresarbeitsentgeltgrenze im laufenden sowie im kommenden überschreiten. Wechselt der Arbeitnehmer den Arbeitgeber und überschreitet hierdurch die Jahresarbeitsentgeltgrenze, endet die Versicherungspflicht mit dem ersten Tag der neuen Beschäftigung.
Was passiert, wenn die Versicherungspflicht endet?
Endet die Versicherungspflicht und schließt sich keine neue an, so wird die Person automatisch zum freiwilligen Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hintergrund ist die sogenannte obligatorische Ausschlussversicherung, welche in § 188 Abs. 4 SGB V gesetzlich geregelt ist. Die freiwillige Mitgliedschaft fängt im Übrigen auch mit dem Ende der Familienversicherung an.
Wer nicht freiwillig gesetzlich versichert sein will, muss innerhalb von zwei Wochen den Austritt erklären und die Mitgliedschaft bei einer privaten Krankenversicherung nachweisen. Eine “Pause” zwischen den Stationen ist nicht zulässig, da der Versicherungsschutz lückenlos bestehen bleiben muss.
Ende der freiwilligen Krankenversicherung
Es gibt drei Konstellationen, durch welche die freiwillige Mitgliedschaft für Versicherte endet.
- Wenn die Voraussetzungen für eine Familienversicherung vorliegen.
- Bei einer fristgerechten Kündigung.
- Mit Beginn der Pflichtmitgliedschaft.
Beiträge berechnen – so geht’s

Die Kosten der freiwilligen Krankenversicherung hängen von einigen Faktoren ab. Für die Höhe der Beiträge ist einerseits entscheidend, ob der Versicherte angestellt oder selbstständig ist und andererseits, welches Volumen seine Einkünfte haben.
Zunächst einmal die wichtigste Regel: Der zu zahlende Beitragssatz von 14,6 Prozent wird um Zusatzbeiträge der jeweiligen Krankenkassen ergänzt. Hinzu kommt der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung.
Für freiwillig versicherte Angestellte übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte der Krankenversicherungsbeiträge und die Hälfte des Zusatzbeitrags.
Selbstständige und Freiberufler zahlen den bereits genannten allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent zuzüglich der Zusatzbeiträge. Auch sie haben einen Anspruch auf Krankengeld ab der siebten Krankheitswoche.
Auch kann ein verminderter Beitragssatz von 14 Prozent gewählt werden, wobei der Versicherte hier auf ein Krankengeld im Falle einer längeren Krankheitsphase verzichtet. Bereits an dieser Stelle soll gesagt sein: Wegen 0,6 Prozent als selbstständige Person auf ein Krankengeld zu verzichten ist weder sinnvoll noch ratsam.
Selbstständige und Freiberufler sind Selbstzahler, genauso wie Studierende, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass – anders als bei Angestellten – für den Beitragssatz nicht nur das reine Arbeitsentgelt, sondern auch andere Einnahmen (wie aus Kapitalvermögen usw.) zur Ermittlung der Beiträge herangezogen werden. Hierzu gleich mehr.
Rentner können einen Zuschuss zur Krankenversicherung in Höhe von 50 Prozent erhalten, wenn sie eine Rente von der Deutschen Rentenversicherung erhalten.
Ein wichtiger Faktor, den Sie kennen sollten, ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Dies ist die Grenze, bis zu der das Einkommen beitragspflichtig ist. Sie liegt 2023 bei 4.987,50 Euro brutto im Monat (59.850 Euro im Jahr). Wer diesen Betrag überschreitet, zahlt auf das “überschüssige” Einkommen keine Sozialversicherungsbeiträge – alles darüber ist also beitragsfrei. Hierzu gleich mehr.
Freiwillige Krankenversicherung: Diese Einkünfte zählen
Bei freiwillig Versicherten, die keine Arbeitnehmer sind, ist das Arbeitseinkommen nicht die einzige Grundlage der Beitragsberechnung. Vielmehr wird die “gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit” von den Krankenkassen für die Berechnung der Beiträge herangezogen. Auch auf diese Einkünfte müssen Krankenkassenbeiträge gezahlt werden:
- Gewinne aus Veräußerungen
- Zinsen aus Kapitalgewinnen
- Renten und Kapitalleistungen aus privaten Lebensversicherungen
- Insolvenzgeld
- Sachleistungen
- Abfindungen oder ähnliche Leistungen, die aufgrund der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gezahlt werden
- Ehegatten- oder Getrenntlebendenunterhalt
Der GKV Spitzenverband hat in seinen Beitragsverfahrensgrundsätzen für Selbstzahler die beitragspflichtigen Einnahmen definiert.
Auch hier beläuft sich der Höchstbetrag für Selbstständige auf rund 808 Euro monatlich inklusive durchschnittlichem Zusatzbeitrag.
Bemessungsgrenze und Mindesteinkommensgrenze
Die gesetzlichen Krankenkassen geben eine Einkommensobergrenze vor, bis zu der maximal Beiträge gezahlt werden müssen. Das Gegenstück hierzu ist die Untergrenze, welche die Mindestbeiträge regelt. Hier wird bei freiwillig Versicherten eine Mindesteinkommensgrenze als fiktives Mindesteinkommen bei der Beitragsberechnung angelegt.
Liegen die Beiträge über der Beitragsbemessungsgrenze, die aktuell (Stand 2023) 4.987,50 Euro beträgt, werden nur Einkünfte bis zu eben dieser Grenze als Grundlage der Berechnung herangezogen. Wer mehr verdient, muss also nicht noch höhere Beiträge zahlen.
Verdient der freiwillig Versicherte weniger als die Mindesteinkommensgrenze, zahlt er nur den Mindestbeitrag. Gleiches gilt für diejenigen, die selbst kein Einkommen haben, aber von nahen Angehörigen oder Lebenspartnern unterstützt werden. Dieser Mindestbeitrag wird anhand der Mindesteinkommensgrenze (Stand 2023: 1.131,67 Euro monatlich) berechnet. Das Einkommen wird fiktiv für die Bemessung zugerechnet: Das bedeutet, dass das tatsächliche Einkommen auch unter diesem Betrag liegen kann.
Die Mindesteinkommensgrenze gilt für freiwillig Versicherte, die nicht angestellt erwerbstätig sind, nicht familienversichert sind, keine Sozialleistungen beziehen und deren Einkünfte unter dem Mindesteinkommen liegen oder die über kein eigenes Einkommen verfügen.
Freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenkasse – Die Leistungen
Die Grenzen der freiwilligen Krankenversicherung liegen in dem Volumen der Leistung. Die gesetzliche Krankenkasse bietet auch für ihre freiwilligen Mitglieder einen eher eingeschränkten Leistungsumfang, der nicht mit den Leistungen einer privaten Krankenversicherung mithalten kann.
Die wichtigste Leistung, neben den üblichen, ist wohl das Zahlen von Krankengeld. Freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Kasse erhalten ebenfalls Elterngeld. Die Prozedur ist jedoch etwas komplizierter als bei Pflichtversicherten.
Privat oder freiwillig gesetzlich versichert – Was ist die bessere Wahl?
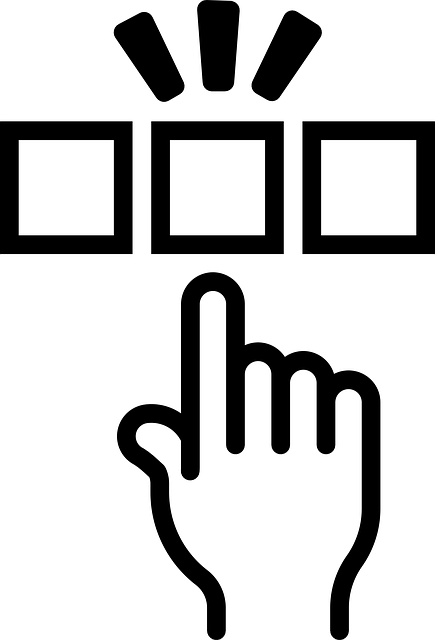
Wie so oft können wir als seriöse Versicherungsmakler und -Berater keine abschließende allgemeingültige Antwort auf die aufgeworfene Frage geben. Hierzu müssten wir alle Faktoren kennen, die Ihren Bedarf und Ihre Vorstellungen von einem passenden und umfassenden Versicherungsschutz ausmachen.
Dennoch teilen wir gerne unsere Gedanken mit Ihnen:
Ja, eine freiwillige Versicherung kann dazu führen, dass die Beiträge niedriger sind als bei einer privaten Krankenversicherung. Dies hängt aber maßgeblich von Ihrem Einkommen ab. Insbesondere wenn Sie selbstständig sind, wird nicht nur das, was Sie unmittelbar durch Ihre Tätigkeit erwirtschaften, zur Bemessung herangezogen, sondern auch weitere Einnahmen, wie oben bereits aufgelistet. Und je nachdem, wie diese ausfallen, könnten die Beiträge doch höher sein als bei der PKV – und das, obwohl Sie deutlich weniger Leistungen erhalten. Bei der PKV sind die Beiträge im Übrigen fix und richten sich nicht nach den Einkünften, wie Sie hier nochmal nachlesen können.
Ein kleiner Denkanstoß: Sind Sie zum Beispiel Beamtin, profitieren Sie bei der PKV durch die Beihilfe, die einen Teil der Beiträge übernimmt. Freiwillig gesetzlich Versicherte haben jedoch keinen Anspruch auf Beihilfe, wobei immer mehr Bundesländer ihren Beamtinnen und Beamten einen Zuschuss zur Versicherung zahlen.
In der Regel können auch Studentinnen und Studenten auf attraktive Einstiegstarife bei der PKV zurückgreifen können.
Andererseits muss sich der Versicherungsnehmer bei der GKV keiner Gesundheitsprüfung unterziehen und kein Risiko von Zuschlägen oder sogar einem Ausschluss bestimmten Erkrankungen wie bei der privaten Versicherung eingehen.
Privatversicherte müssen außerdem bei Rechnungen in Vorleistung treten, ganz gleich, wie hoch diese ist. Dies kann für viele höchst beunruhigend sein und zu einer Hemmschwelle, medizinischen Versorgung in Anspruch zu nehmen, führen. Hierin liegt wiederum ein Vorteil der GKV gegenüber der PKV, da hier nur die gesetzlichen Zuzahlungen geleistet werden müssen. Es müssen keine Rechnungen eingereicht werden, das Vorzeigen der Gesundheitskarte genügt.
Letzten Endes ist es eine Beitrags- und Leistungsfrage, die jeder für sich abschätzen und beantworten muss. Wir stehen Ihnen mit unserem Know-how als freie Versicherungsmakler und Berater als starker Partner zur Seite. Wir beantworten alle Ihre offenen Fragen, bestimmen gemeinsam Ihren Bedarf und erörtern Ihre Anforderungen an den Leistungsumfang und den gewährten Schutz, wobei wir auch die Kosten des jeweiligen Versicherungsstatus nicht aus dem Blick verlieren. Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit für ein unverbindliches Erstgespräch.
Fazit: Freiwillig gesetzlich krankenversichert
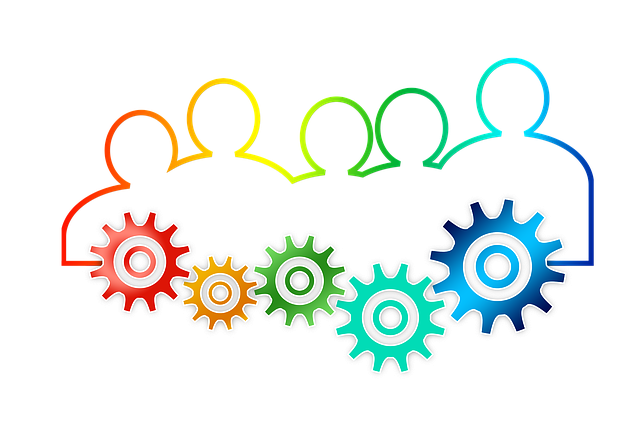
Die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung ist eine Versicherungsmöglichkeit für Personen, die nicht pflichtversichert sind. Die freiwillige GKV steht vielen Menschen offen: Selbstständige, Studenten, Kinder im Rahmen der Familienversicherung, Rentner und Beamtinnen, aber auch Angestellte können sich zwischen der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung entscheiden. Durch die freiwillige Krankenversicherung sind Sie auch außerhalb der Pflichtversicherung gegen Krankheitskosten abgesichert.
Die freiwillige Krankenversicherung kommt sowohl für Selbstständige als auch für Angestellte, die nicht automatisch durch ihr Arbeitsentgeld in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) pflichtversichert sind, infrage. Die Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse ermöglicht aber nicht nur den eben genannten Personen den Zugang zu medizinischer Versorgung, sondern bietet beispielsweise auch Rentnern und Beamten finanzielle Absicherung bei Krankheit.
Ein Kernaspekt der freiwilligen Krankenversicherung ist der Anspruch auf Krankengeld. Im Falle einer Erkrankung erhalten Versicherte dieses, um ihren Lebensunterhalt weiter bestreiten zu können. Dies ist besonders für Selbstständige und freiberuflich Tätige von großer Bedeutung, da sie bei Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung haben. Wer jedoch über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig wird, den schützt nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung umfassend.
Die Beitragsberechnung und somit die Kosten für die freiwillige Mitgliedschaft richten sich nach dem Einkommen und können somit individuell variieren.
Bei der Auswahl der Krankenkasse ist der Beitragszahler frei, und es gibt zahlreiche gesetzliche Krankenkassen, bei denen man sich versichern kann. Dabei ist es stets wichtig, die Leistungen und Beitragssätze zu vergleichen, um die optimale Kasse bzw. Versicherungsform zu finden. Gleiches gilt für die Gegenüberstellung mit der PKV, deren Leistungsfülle und konstanten Beiträge ebenfalls für sich sprechen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Nutzen Sie die Möglichkeit der transparenten und ehrlichen Beratung auf höchstem Niveau, bei der Sie im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen!
Insgesamt bietet die freiwillige GKV eine mögliche Option der Absicherung für verschiedene Personengruppen. Ob Selbstständige, Studenten oder Rentner – die flexible Art der Mitgliedschaft ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Lebenssituation und sorgt für notwendige Sicherheit im Krankheitsfall.






4 Antworten
Kann man von der freiwilligen Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln.
Hallo Herr Schnabel, hier erfahren Sie mehr darüber: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2022/220221_kvdr_in_pflichtversicherung_wechseln.html
Es gibt noch einen Mittelweg zwischen GKV und PKV: Indem man als gesetzlich Versicherter vom Sachleistungsprinzip zum Kostenerstattungsprinzip wechselt (Paragraph 13(2) SGB V: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__13.html), tritt man beim Arzt als Selbstzahler auf, und der Arzt kann nach GOÄ abrechnen.
Die Rechnung wird dann zunächst bei der GKV eingereicht, und je nachdem, ob sie in Vorleistung geht, zahlt dann eine private Zusatzversicherung die Restkosten (zwischen 0 und 100 Prozent, je nach Tarif, da sollte man gut aufpassen).
Für den ambulanten Bereich kenne ich nur sehr wenige solcher Tarife, z.B. die ARAG 181 – 183, DKV KAMP oder DKV BMG.
Diese Tarife finde ich durchaus interessant, wenn die Voll-PKV nicht möglich ist oder nicht passend, gerade auch für Kinder. Schade, dass es so wenig Informationen dazu gibt.
Hallo Herr Fitz, Sie haben vollkommen Recht. Ich glaube, dass man deswegen darüber so wenig liest und wenige darüber Bescheid wissen, weil diese Tarife sehr teuer sind. Als Beispiel kostet der Tarif bei der DKV für jmd. der 1994 geboren ist knapp 250 € pro Monat. Das muss man sich erstmal leisten können und wollen. Hier gehts zum Onlinerechner: https://www.dkv.com/produkte-rundum-zusatzversicherung.html